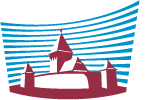„In den Dörfern war die Kirche immer wie ein Schloss von einer Mauer umgeben, mit Wachtthürmen, starken Thoren, einem Graben mit Zugbrücke oder nach Umständen einer zweiten inneren Mauer. Es war der Zufluchtsort der Gemeinde bei Annäherung des Feindes, und hieher brachte sie auch ihre Habe und ihr Korn, sodass sie, wenn das Land verwüstet und die Ernte zerstört war, wenigstens einen Vorrath hatten, um die Greuel einer Hungersnoth von sich abzuwenden.“
Charles Boner: Land und Leute in Siebenbürgen, Leipzig 1868
Der Verteidigung der neuen Siedlungen wurde spätestens seit dem Mongolensturm (1241–1242) besondere Bedeutung beigemessen. Anfänglich legte man Burgen in Höhenlagen an, später wurden die dörflichen Kirchen mit Gräben, Wällen und Palisadenzäunen befestigt. Diese ersetzte man nach den ersten osmanischen Einfällen zu Beginn des 15. Jahrhunderts durch aufgemauerte, mit Wehrtürmen versehene Ringmauern, den Beringen. Im Burginneren entstanden Fruchthäuser und Vorratskammern, die in Belagerungszeiten auch den Dorfbewohnern Zuflucht boten. Mit Ausnahme des Burzenlandes wurden meistens auch die Kirchenbauten selbst befestigt: Zwischen den Kirchenschiffen und Dachstühlen entstanden Wehrgeschosse, die zunächst in Fachwerk ausgeführt und später auf Strebepfeilern lagernden, sogenannten Wehrbögen massiv aufgemauert wurden. Im Kokelgebiet und im Harbachtal erhielten auch die Chorräume turmartige Überbauungen, die, wie auch die verstärkten Westtürme, Wehrgänge erhielten. Die Hauptportale wurden vermauert, die Kirchen erhielten stattdessen Seitenpforten.
Mit dem Einkehren friedlicherer Zeiten zu Beginn des 18. Jahrhunderts verloren die Befestigungen ihre Funktion. Im 19. Jahrhundert wurden die Verteidigungsanlagen an einigen Kirchen zurückgebaut. Eine Reihe von Kirchenburgen verlor ihre Beringe, wobei die Wehrtürme häufig als Zeichen der Tradition und einstigen Wehrhaftigkeit erhalten blieben. Das Abbruchmaterial fand Verwendung im Bau von Schulen, Pfarr- oder Gemeindehäusern.

Zu den frühen Konstruktionsformen von befestigten Kirchen zählt das Gotteshaus von Probstdorf mit dem über dem Langhaus errichteten Fachwerk-Wehrgeschoss. Vor der Westfassade entstand ein mächtiger Befestigungsturm mit gedeckter Wehrplattform. Foto: Arne Franke 
Als mächtigste Anlage ihrer Art entstand seit dem 13. Jahrhundert die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Kirchenburg von Tartlau. Die unbefestigte Kirche erhebt sich im Zentrum des stark bewehrten, bis zu 14 Meter hohen Berings. Foto: Arne Franke 
In Heltau wurde die romanische Basilika, die nach 1241 einen ovalen Bering erhielt, um 1430 zusätzlich befestigt. Die Seiteneingänge erhielten aufgesetzte Flankentürme und der Chor einen viergeschossigen Wehrturm. Fotografie um 1940. Foto: Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg, Gundelsheim am Neckar 
Die 1523 errichtete Saalkirche von Bußd bei Mühlbach war von Anfang an befestigt. Charakteristisch sind die Rhythmisierung mit Strebepfeilern, gestuften Konsolen und zwischenliegenden Gussscharten sowie das Wehrgeschoss mit Schießscharten. Seitenschiffe der Basilika abgebrochen und die Arkaden vermauert. Chor und Westturm erhielten eine Wehrplattform. Stefan Bichler 
Um die Kirchenburg von Bußd bei Mediasch ostseitig gegen den ansteigenden Hang zu schützen, wurde der gotische Chorraum mit einem eindrucksvollen Wehrturm überbaut. Zudem sicherte ein weiterer, heute nicht mehr erhaltener Westturm die Kirchenburg ab. Foto: Martin Eichler 
Die nach 1500 errichteten Befestigungsanlagen der gotischen Kirche von Agnetheln wurden im 19. Jahrhundert ebenso beseitigt wie der sie umgebende Bering. Erhalten blieben die Wehrtürme als beredtes Zeichen der einstigen Wehrhaftigkeit.