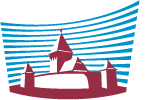„Siebenbürgen ist in vielerley Betracht ein Land, welches wirklich verdiente, nicht nur den Gelehrten, sondern auch den übrigen von allen Ständen bekannter zu seyn.“
Paul Rudolph Gottschling:
Die Sachsen in Siebenbürgen. Ein Beytrag zur Erd- und Menschenkunde, Dresden 1794
Die ins östliche Europa gerichtete deutsche Siedlungsbewegung fand im 12. und 13. Jahrhundert ihren Weg auch in das damals zu Ungarn gehörende Siebenbürgen. Die Siedler, nach einer ungarischen Bezeichnung bald „Sachsen“ genannt, erhielten Territorien vor allem im Süden zugewiesen. Ihre Aufgabe war die wirtschaftliche Erschließung und militärische Sicherung des Landes. Auf dem sogenannten Königsboden wurden den Siedlern freiheitliche Rechte verliehen. Dadurch konnten sich ihre Städte und Dörfer auf lange Sicht gegenseitig stützen sowie Rechtsstand, Konfession und Sprache bewahren.
Die neu gegründeten Ortschaften kamen bald zu Wohlstand – sichtbar an ihren Kirchenbauten. Sie waren dadurch aber auch der Bedrohung durch das sich ausdehnende Osmanische Reich ausgesetzt. Die Städte reagierten durch die Anlage von Stadtmauern, die Dörfer mit dem Bau von Kirchenburgen. Im 15. Jahrhundert boten sie Schutz vor den zahlreichen osmanischen Überfällen und Raubzügen, nicht jedoch vor größeren Heerzügen. Im 16. und 17. Jahrhundert kam die Schutzfunktion vor den Kriegen zwischen den beiden Machtblöcken Osmanisches Reich und Habsburgerreich hinzu. Nach 1711 verloren die Kirchenburgen ihre militärische Rolle, wurden aber als identitätsbestimmende Bauten der Dorfbewohner weiterhin gepflegt und erhalten.
Durch die lutherische Reformation und die Rolle eines staatstragenden Standes ab Mitte des 16. Jahrhunderts konnte sich die Gruppenidentität der deutschen Siedler nachhaltig festigen. Zu gemeinsamer Sprache, politischem Selbstbewusstsein und konservativem Luthertum kamen in der Neuzeit weitere Aspekte wie die Kirchenburgen als Sinnbilder ererbter Wehrhaftigkeit hinzu. Der Erhalt dieses Kulturguts rückte vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ins Bewusstsein.

Die ungarischen Könige, insbesondere Géza II. (1130–1162) und Andreas II. (um 1177–1235), waren die Initiatoren der mittelalterlichen Besiedlung Siebenbürgens. Sie gewährten den deutschen Siedlern auf dem Königsboden weitgehende Rechte. Foto: Wikipedia commons 
In der verheerenden Schlacht mit dem osmanischen Heer 1526 in Mohács – hier in einer zeitgenössischen türkischen Miniatur – fiel der junge ungarische König Ludwig II. (1506–1526) Infolge eines Erbvertrages mit den Habsburgern ging seine Krone auf diese über. Foto: Wikipedia commons 
Ab den 1520er Jahren verbreiteten sich die Lehren Martin Luthers unter den Siebenbürger Sachsen. Als deren Reformator gilt der Kronstädter Ratsherr und Universalgelehrte Johannes Honterus (1498–1549), dessen Kirchenordnung 1547 erschien. Foto: Arne Franke 
Samuel von Brukenthal (1721– 1803), Sohn eines sächsischen Königsrichters, wurde unter Maria Theresia Gouverneur Siebenbürgens. Er setzte sich für die Rechtstitel der Sachsen ein und hinterließ eine der bedeutendsten Kunstsammlungen Ostmitteleuropas. Foto: Landeskirchliches Museum der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Sibiu 
Der befestigte Wohnturm von Kelling ist das architektonische Erbe eines Gräfen, einem Vertreter der aus dem niederen Adel hervorgegangenen Führungsschicht der ersten sächsischen Einwanderer. Die Anlage steht heute unter UNESCO-Weltkulturerbeschutz. Foto: Arne Franke 
Historische Einteilung Siebenbürgens um 1800 Karte: Dirk Bloch